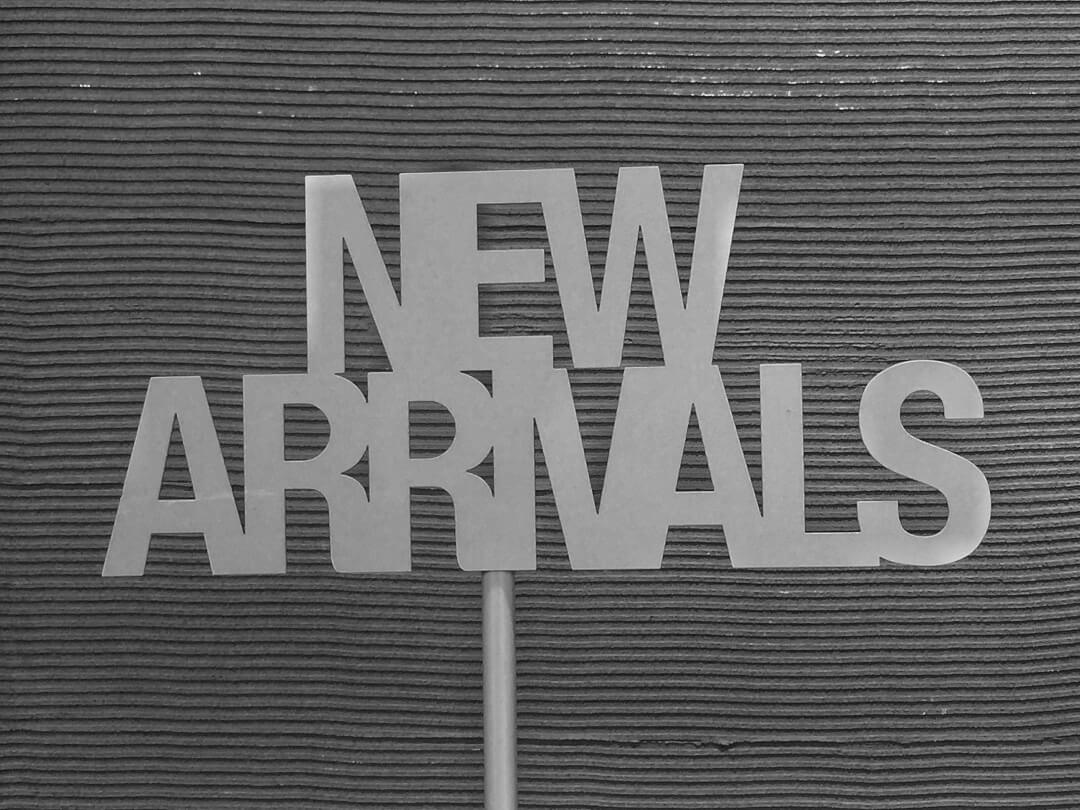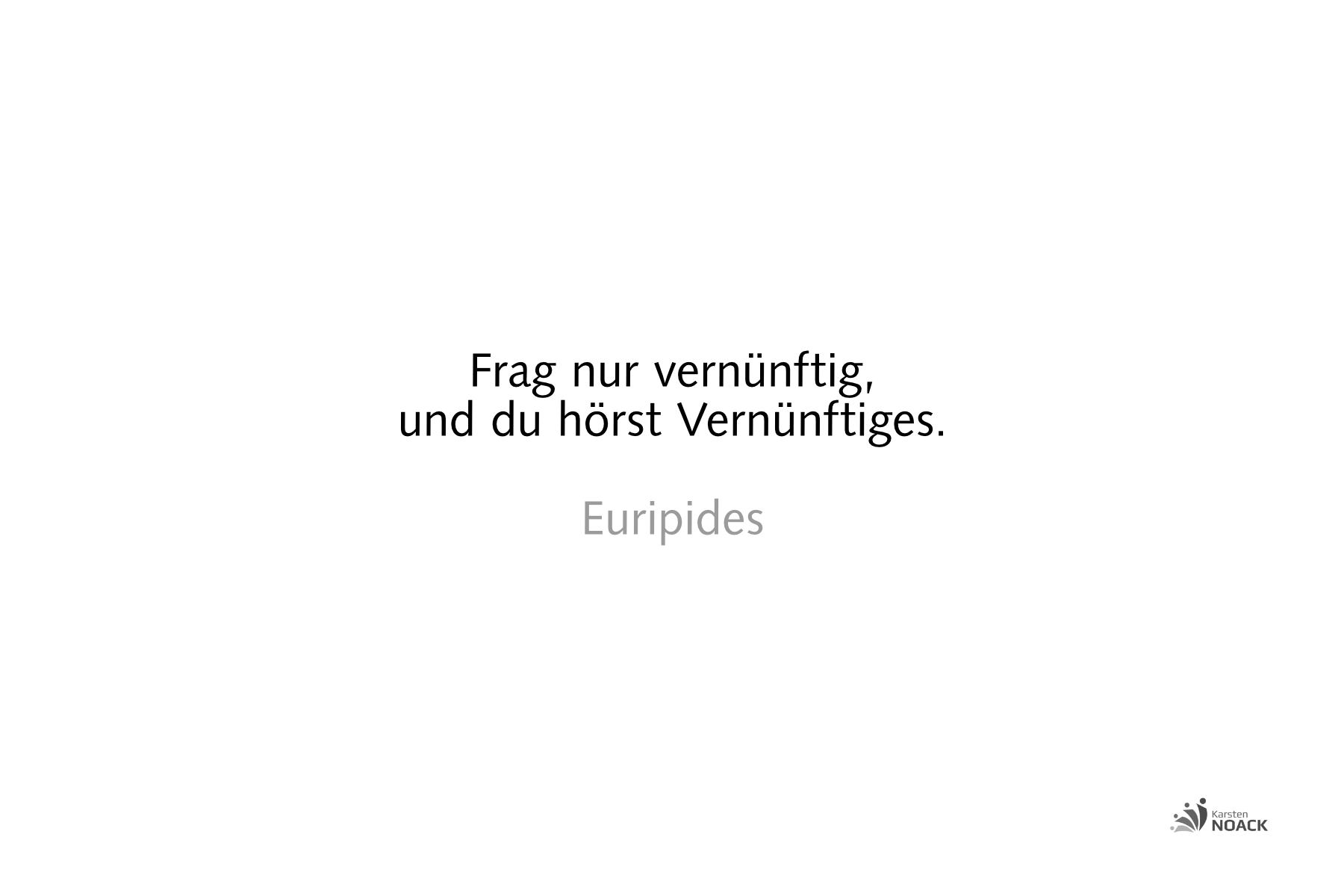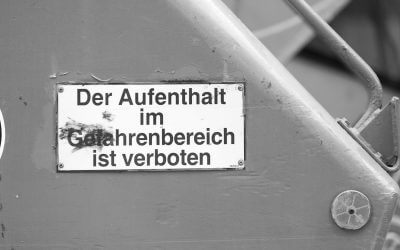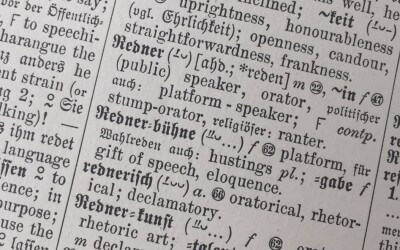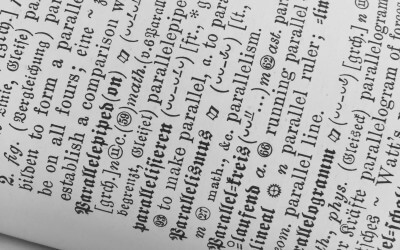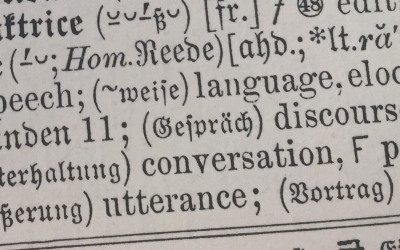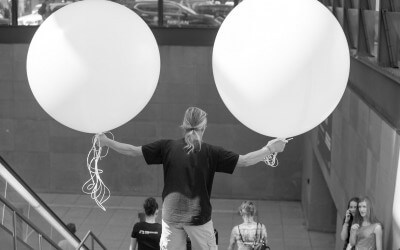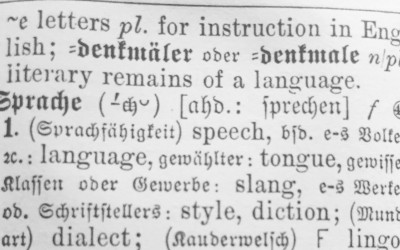In diesem Beitrag geht es darum, wie sich Daten aussagekräftig präsentieren lassen.
Psychologie und wirkungsvolle Präsentationen
Psychologie und wirkungsvolle Präsentationen
Überzeugend präsentieren
Psychologie und wirkungsvolle Präsentationen
Welche hilfreichen Erkenntnisse liefert die Psychologie für wirkungsvolle Präsentationen?

Psychologie und wirkungsvolle Präsentationen
Erkenntnisse der Psychologie können dazu beitragen, Präsentationen noch wirkungsvoller zu machen. Darum geht es in diesem Beitrag.
1. Portionsgröße und Abwechslung
Laut Neurowissenschaftler John Medina neigen Menschen dazu, nach zehn Minuten die Konzentration zu verlieren. Ist die Präsentation länger, dann gilt es, für entsprechende Abwechslung zu sorgen. Sonst schaltet das Publikum ab beziehungsweise um. Schon ist das Smartphone gezückt und die Aufmerksamkeit ist anderswo.
Sorgen Sie für Kontrast in Ihren Präsentationen, damit Ihr Publikum Ihnen weitere 10 Minuten zuhört. Bringen Sie beispielsweise Humor ein, spielen Sie mit Ihrer Stimme, beteiligen Sie das Publikum, machen Sie etwas Unerwartetes, wechseln Sie das Medium.
2. Struktur
Bringen Sie Ihren Inhalt in eine geeignete Struktur ein. Matt Abrahams von der Stamford Graduate School of Business behauptet, dass strukturierte Präsentationen um 40 % leichter zu behalten ist, als Präsentationen, die keiner Struktur folgen.
So kommen Sie zu einer Struktur: Sie wählen eine der beschriebenen Redestrukturen oder Sie beantworten einfach die folgenden drei Fragen:
- Was?
- Was bedeutet das?
- Was jetzt?
3. Alle guten Dinge sind DREI
Wenden Sie das Prinzip der Dreierregel an, denn die Zahl Drei wirkt magische. Es ist vermutlich kein Zufall, dass die meisten Abkürzungen, die mir in den Sinn kommen, aus drei Buchstaben bestehen; CAD, CEO, CFO usw.
Was bedeutet das für unsere Präsentationen? Es bedeutet, dass Sie bei jeder Präsentation nicht mehr als drei Argumente anführen sollten. Und wenn Sie beispielsweise die Vorteile eines Produkts vorstellen, solltest du nicht acht, sondern die drei besten davon aufzählen. Im Durchschnitt merken sich Menschen nicht mehr als drei Ideen für etwas, also helfen Sie ihnen, sich die wesentlichsten zu merken, anstatt sie nicht mit einer Flut von Informationen zu überfordern.
4. Die Augen essen mit
Sprechen Sie alle Sinne. Nutzen Sie bei Präsentationen vor allem die visuellen Mittel. Die meisten Menschen sind visuell geprägt und wir merken uns Informationen viel leichter und besser, wenn wir ein entsprechendes Bild gesehen haben. Anstatt also nur zu sprechen und Ihre Stimme zu benutzen, solltest du Bilder auf Ihren Folien verwenden, die das Gesagte unterstützen und Ihren Zuhörern helfen, sich Ihre Botschaft besser zu merken. Wobei Sie Bilder auch mit Sprache und Körpersprache entstehen lassen können.
5. Präsentieren statt vorlesen
Lesen Sie die Folien nicht vor. Folien sind dazu da, Sie zu unterstützen und nicht zu ersetzen. Erstens spricht das nur den auditiven Kanal, also die Ohren, an. Setzen Sie Folien als Ergänzung zu Ihrer bewegenden Rede ein, sprechen Sie sowohl den Audio- als auch den visuellen Kanal Ihres Publikums an. Das erhöht auch die Chance, dass Sie und Ihre Botschaft in eine gute Position, im Langzeitgedächtnis gespeichert zu werden. Wir haben übrigens mindestens fünf Sinne, die angesprochen werden können. Sorgen Sie für sinnliche Erlebnisse.
6. Überschriften
Nehmen Sie sich Zeit für die Überschriften. Aussagekräftige Überschriften helfen Ihnen, Ihre Folienbotschaft effizienter zu vermitteln. Sie können entweder ein einzelnes Wort, eine kurze Phrase oder sogar einen ganzen Satz verwenden. Bringen Sie es auf den Punkt. Weniger ist mehr, wenn es so besser haften bleibt.
7. Das Gehirn liebt Geschichten
Erzählen Sie relevante Geschichte. Eine der Untersuchungen, die diese Aussage bestätigen, stammt von Paul Zak. Er spielte ein Video ab, in dem eine Geschichte erzählt wurde. Bevor er es abspielte, nahm er seinen Probanden Blut ab. Anschließend nahm er erneut Blut ab. Es stellte sich heraus, dass als Folge der Geschichten zwei chemische Stoffe im Körper der Menschen freigesetzt wurden; Oxytocin und Cortisol.
Oxytocin ist verantwortlich für Fürsorge, Verbundenheit und Einfühlungsvermögen. Cortisol ist für die für erhöhte Konzentration und Aufmerksamkeit verantwortlich ist, oder anders ausgedrückt. Wollen Sie das also bei Ihrem Publikum fördern, dann setzen Sie bei der nächsten Präsentation auf Storytelling.
Ja, und?
Haben Sie etwas Neues gelernt? Lassen Sie es mich in den Kommentaren wissen.
Ergänzende Artikel
- Antworten auf 33 häufige Fragen zur Präsentationsvorbereitung
- So probst du Reden und Präsentationen für mehr Sicherheit und Wirkung
- Eine herausragende Rede oder Präsentation als rhetorisches Meisterstück
- Präsentationen mit Präsentationsprogrammen
- 14 Tipps, wie du mutig für deine Überzeugung einstehen
Frage mich ruhig persönlich
Bei Interesse, für persönliche Fragen und Terminvereinbarungen, kommen wir am leichtesten über das nachfolgende Kontaktformular zusammen. Auch per E-Mail (mail@karstennoack.de) bin ich zu erreichen. Die Anzahl der Anrufe wurde so groß, dass ich nun ausschließlich auf diese Nachrichten reagiere. Klienten erhalten entsprechende Telefonnummern.
Hinweise zum Datenschutz findest du hier. Transparenz ist wichtig. Antworten auf häufige Fragen befinden sich deswegen schon hier, wie beispielsweise zu mir (Profil), den Angeboten, den Honoraren und dem Kennenlernen. Wenn das passt, freue ich mich auf eine intensive Zusammenarbeit.
Um es uns beiden leicht zu machen, bitte ich dich dieses Formular zu nutzen. Bis auf die E-Mail-Anschrift ist dir überlassen, was du einträgst. Umso genauer du bist, desto einfacher folgt von mir eine qualifizierte Antwort. Mit dem Absenden erklärst du dich damit einverstanden, dass die im Kontaktformular eingegebenen Daten elektronisch gespeichert und zum Zweck der Kontaktaufnahme verarbeitet und genutzt werden. Dir ist bekannt, dass du deine Einwilligung jederzeit widerrufen kannst. Ich werde die Daten ausschließlich dafür verwenden und so bald wie möglich löschen. Ist die Nachricht unterwegs, erscheint an der Stelle des Kontaktformulars der Hinweis "Die Nachricht ist unterwegs!". Ich antworte üblicherweise innerhalb von 24 Stunden —meist sehr schnell.
3 Tipps für eine aussagekräftige Präsentation von Daten
Die 3-Schritte-Formel für herausragende Präsentationen
Der Beitrag beschreibt einen Weg, bei dem sich in drei Schritten herausragende Präsentationen erreichen lassen.
Brand Strategy (Markenstrategie): Was und wie?
Zu den Grundlagen für den Erfolg eines Angebots, einer Marke, gehört die sogenannte Brand Strategy – wir haben das früher Markenstrategie beziehungsweise Markenentwicklungsstrategie genannt.
Komfortzone
Was ist das mit diesem Bereich, der sich Komfortzone nennt?
So hilft Business Storytelling im Management
Professionelles Storytelling als Managementwerkzeug. 7 Gründe, warum Business Storytelling helfen kann.
Überzeugende introvertierte Rednerinnen und Redner
Gründe, weshalb introvertierte Menschen selbstbewusste Redner und Rednerinnen werden können, die besonders überzeugend sind.
Umgang mit Schwachstellen in der eigenen Argumentation
Was tun, wenn wir in der eigenen Argumentation eine Schwachstelle erkennen und sie sich nicht so einfach beheben lässt? Hier die Antwort auf eine häufige Frage.
5 unverzichtbare Elemente eines Pitchs
In diesem Beitrag geht es um die wichtigsten Elemente eines vollständigen Pitchs.
Polemik, Polemiker und 6 Tipps, zum Umgang damit
Häufig werde ich gefragt, wie mit Polemik umgegangen werden soll. Deswegen habe ich hier ein paar grundsätzliche Empfehlungen für den Fall der Fälle. So lässt sich mit Polemik umgehen, gegen Polemikern wehren. Tipps für verbales Judo!
Berühmt, lohnt sich das? Mitunter hilft ein Bekanntheitsgrad
In diesem Artikel geht es um die Frage, wann und wofür ein höherer Bekanntheitsgrad nützlich sein kann.
19 Tipps für erfolgreiche Radiointerviews
Öffentlichkeit zu bekommen ist eine willkommene Gelegenheit, sich so zu präsentieren, wie Sie gesehen werden wollen. Und ein Radiointerview liefert Ihnen diese Gelegenheit. Erfahren Sie, was zu beachten ist.
Starkes Lampenfieber und Redeangst sind schlecht für die Karriere
Starkes Lampenfieber und Redeangst sind schlecht für die Karriere. In vielen Bereichen werden überzeugende Redebeiträge erwartet, was tun?
Pecha Kucha in 8 Schritten vorbereiten und 9+ Tipps: Schluss mit Death by PowerPoint
Pecha Kucha bedeutet laut Übersetzer soviel wie wirres Geplauder, Stimmengewirr. Doch das ist nicht das beabsichtigte Ziel dieser Vortragsform. So wird eine Pecha Kucha Präsentation in 8 Schritten vorbereitet. Und es gibt 9+ Tipps.
Die häufigsten Fehler beim Storytelling
So umschiffen Sie die häufigsten Fallgruben bei professionellem Storytelling. Was sind die typischen Fehler beim strategischem Erzählen von Geschichten und wie lassen sie sich vermeiden?
Besser präsentieren mit der 10-20-30-Regel
Erfahre, wie die 10-20-30-Regel dabei helfen kann, effektiv zu präsentieren. Und das nicht nur beim Pitch vor Kapitalgebern, sondern auch bei vielen anderen Präsentationen.
Redestrukturen für deinen Redeaufbau: Gut für die Redner, gut für das Publikum
Mach es dir und deinem Publikum mit geeigneten Redestrukturen leichter. Deine Vorteile sind der für dich leichtere Aufbau einer wirksamen Rede oder Präsentation und auch die Zuhörer finden sich besser zurecht, Du und deine Botschaft überzeugen und wirken.
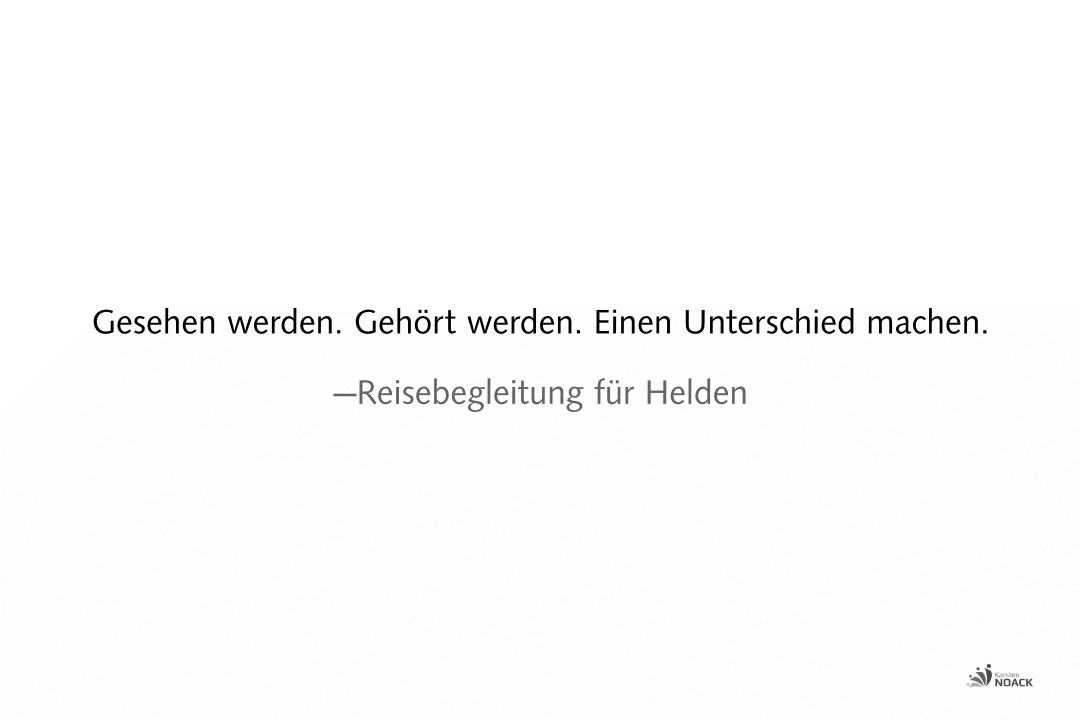
Die Artikel sind meist kurze Auszüge der umfangreicheren Kursunterlagen, die Teilnehmende im entsprechenden Gruppen- oder Einzeltraining oder im Coaching erhalten.
Autor: Karsten Noack
Erstveröffentlichung: 13. März 2018
Überarbeitung: 11. August 2020
AN: #937
K: CNC
Ü: